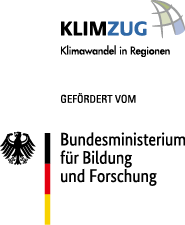Dynamische Anpassung regionaler Planungs- und Entwicklungsprozesse an die Auswirkungen des Klimawandels
dynaklim – Am Beispiel der Emscher-Lippe-Region (Ruhrgebiet)

Unter Gesamtkoordination des FiW wurden in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Netzwerk- und Forschungsprojekt dynaklim zwischen Juli 2009 und Februar 2015 gemeinsam mit den Akteuren in der Emscher-Lippe-Region die Basis und wichtige Bausteine für eine zukünftige, vorausschauende Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels entwickelt.